Anwalt für Brandstiftung
Engagierte Strafverteidigung

Das Deliktsfeld der Brandstiftung ist in den §§ 306 bis 306f des Strafgesetzbuchs (StGB) geregelt.
Die Brandstiftung zählt zum Bereich der gemeingefährlichen Straftaten und wird bereits bei Verwirklichung des Grunddelikts, also der einfachen Brandstiftung mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geahndet, womit die Brandstiftung aufgrund der Mindeststrafhöhe als Verbrechen und nicht mehr als Vergehen gewertet wird.
Der Vorwurf der Brandstiftung ist somit ein erheblicher Tatvorwurf, welchem oftmals komplexe Fälle zugrunde liegen. Nicht selten werden dazu infolge einer Brandstiftung Menschen mitunter schwer verletzt oder gar getötet, weswegen der Vorwurf der Brandstiftung häufig mit anderen, ebenfalls gravierenden Tatvorwürfen verbunden ist.
Dazu kommt es neben der strafrechtlichen Thematik häufig aufgrund der durch die Brandstiftung verursachten, nicht selten besonders erheblichen Sachschäden zu entsprechend hohen zivilrechtlichen Schadensersatzforderungen, welchen Sie im Idealfall mit Unterstützung eines engagierten Rechtsanwalts entgegen treten.
Von besonderer praktischer Bedeutung sind die häufigen Fälle, in denen mittels einer Brandstiftung ein Versicherungsbetrug begangen werden soll (sogenannter "warmer Abriss").
Aufgrund der Vielzahl der strafrechtlichen aber auch zivilrechtlichen Anknüpfungspunkte und der hohen Strafandrohung empfiehlt es sich bei der Verteidigung gegen den Vorwurf der Brandstiftung einen erfahrenen und spezialisierten Strafverteidiger zu konsultieren.
Aufgrund des hohen Strafrahmens und der Qualifizierung der Brandstiftungsdelikte als Verbrechen kommt in derartigen Fällen regelmäßig eine Pflichtverteidigung in Betracht.
Was ist Brandstiftung?
Eine Definition
Brandstiftungsdelikte sind eine Sonderform der Sachbeschädigung und beziehen sich auf die vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung von bestimmten Objekten oder Strukturen durch Feuer.
Zu den durch den Tatbestand der Brandstiftung geschützten Objekten zählen nicht nur alle Arten von Gebäuden, sondern unter anderem auch Betriebsstätten, Maschinen, Fahrzeuge, Wälder, Moore sowie Land- und forstwirtschaftliche Güter.
Der Tatbestand ist denkbar einfach erklärt: Der Täter setzt typischerweise eine fremde Sache in Brand oder legt einen Brand, welcher zur vollständigen oder teilweisen Zerstörung des durch den Verbotstatbestand geschützten Objekts führt.
Strafverfahren rund um Brandstiftungsdelikte sind häufig komplexe Verfahren, welche regelmäßig nur mit der Beteiligung von Gutachtern und Sachverständigen bereits im Ermittlungsverfahren bewältigt werden können. Nur so können wichtige Beweisfragen z.B. zur Brandverursachung, dem Brandverlauf, etc. geklärt werden. Zwecks der Beurteilung der Gutachten im Rahmen einer Akteneinsicht ist ein in diesem Deliktsfeld erfahrener Rechtsanwalt behilflich.
Bei einem Vorwurf aus dem Deliktsfeld der Brandstiftung gemäß §§ 306 ff. StGB ist es von immenser Bedeutung für eine möglichst erfolgreiche Verteidigung, so schnell wie möglich einen spezialisierten und erfahrenen Strafverteidiger zu konsultieren, um individuelle rechtliche Beratung und eine auf den konkreten Einzelfall angepasste Verteidigungsstrategie zu erhalten.
Inbrandsetzung vs. Brandlegung
Unterschiedliche Begehungsformen
Eine Brandstiftung als Grunddelikt kann auf zwei unterschiedliche Arten begangen werden. Zum einen besteht die Möglichkeit der Brandstiftung durch Inbrandsetzung, zum anderen kann die Brandstiftung auch durch sogenannte Brandlegung begangen werden:
- Inbrandsetzung
In Brand gesetzt ist ein Objekt, wenn ein wesentlicher Bestandteil dessen in solcher Weise vom Feuer ergriffen ist, dass es auch nach dem Entfernen oder Erlöschen des Zündstoffes (z.B. Feuerzeug, Streichholz) selbstständig weiterbrennen kann.
Wesentlich ist ein Bestandteil dann, wenn dieser nicht jederzeit entfernt werden kann, ohne dass das geschützte Objekt in seiner bestimmungsgemäßen Funktion beeinträchtigt wäre.
- Brandlegung:
Da viele moderne Gebäude unter Verwendung von brandhemmenden oder feuerfesten Materialien errichtet wurden ist es häufig nicht mehr möglich diese entsprechend der o.g. Definition Inbrandzusetzen. Trotzdem kann es zu erheblichen Schäden und Gefahren durch z.B. Hitze-, Rauchgasentwicklung sowie Verrußung kommen. Ebenso können Schäden und Gefahren entstehen wenn der Zündstoff (z.B. Benzin) anstatt zu brennen explodiert. Daher begeht eine Brandstiftung auch diejenige Person, welche ein geschütztes Objekt durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört, wobei sich die Zerstörung auch auf wesentliche Bestandteile des Objekts beziehen muss.
Für eine Brandlegung reicht jede Handlung aus, welche auf das verursachen eines Brandes gerichtet ist .
Wie wird Brandstiftung bestraft?
Strafrahmen der Brandstiftungsdelikte
Beim Grundtatbestand, der "einfachen" vorsätzlichen Brandstiftung beträgt der Strafrahmen zwischen 1 Jahr Freiheitsstrafe und zehn Jahren Freiheitsstrafe.
In minder schweren Fällen, welche vom Gericht im Einzelfall festgestellt werden müssen, beträgt der Strafrahmen zwischen sechs Monaten und 5 Jahren Freiheitsstrafe.
Einschließlich aller durch sogenannte Qualifikationen zu verwirklichenden Tatbestände ist z.B. in dem Fall dass durch die Brandstiftung eine andere Person ums Leben kommt auch eine lebenslange Freiheitsstrafe möglich.
Die Verurteilung zu einer Geldstrafe ist bei einer Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung somit ausgeschlossen, bei fahrlässiger Brandstiftung jedoch grundsätzlich möglich.
Freiheitsstrafen bis zu einer maximalen Dauer von 2 Jahren können bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen jedoch im Einzelfall zur Bewährung ausgesetzt werden.
Was gilt im Jugendstrafrecht?
Besonderheiten bei jugendlichen Tätern
Jugendliche und Heranwachsende kommen im Deliktsfeld der Brandstiftung häufig als Täter vor.
Im Jugendstrafrecht finden die Strafrahmen des Strafgesetzbuchs (StGB) keine Anwendung.
Der Fokus der Strafverfolgungsbehörden und Jugendgerichte liegt mithin nicht nur auf der Aufklärung der Brandursachen, sondern ausgerichtet am Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts besonders verstärkt auch auf den Beweggründen und Motiven der vorgeworfenen Taten.
Im Urteil soll dann nach einer Gesamtschau der Tat, sowie der Persönlichkeit des Täters eine Sanktion gebildet werden, durch welche die erzieherische Einwirkung auf den Jugendlichen oder Heranwachsenden erfolgen kann. Dabei stehen dem Gericht aus dem Katalog der Sanktionsmöglichkeiten des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) verschiedene Auflagen, Weisungen, Zuchtmittel und als härteste Sanktion die Jugendstrafe zur Verfügung.
Daher ist gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden Tatverdächtigen die besonders sorgfältig, unter Mithilfe eines erfahrenen Verteidigers ausgearbeitete Verteidigungsstrategie von ganz erheblicher Bedeutung.
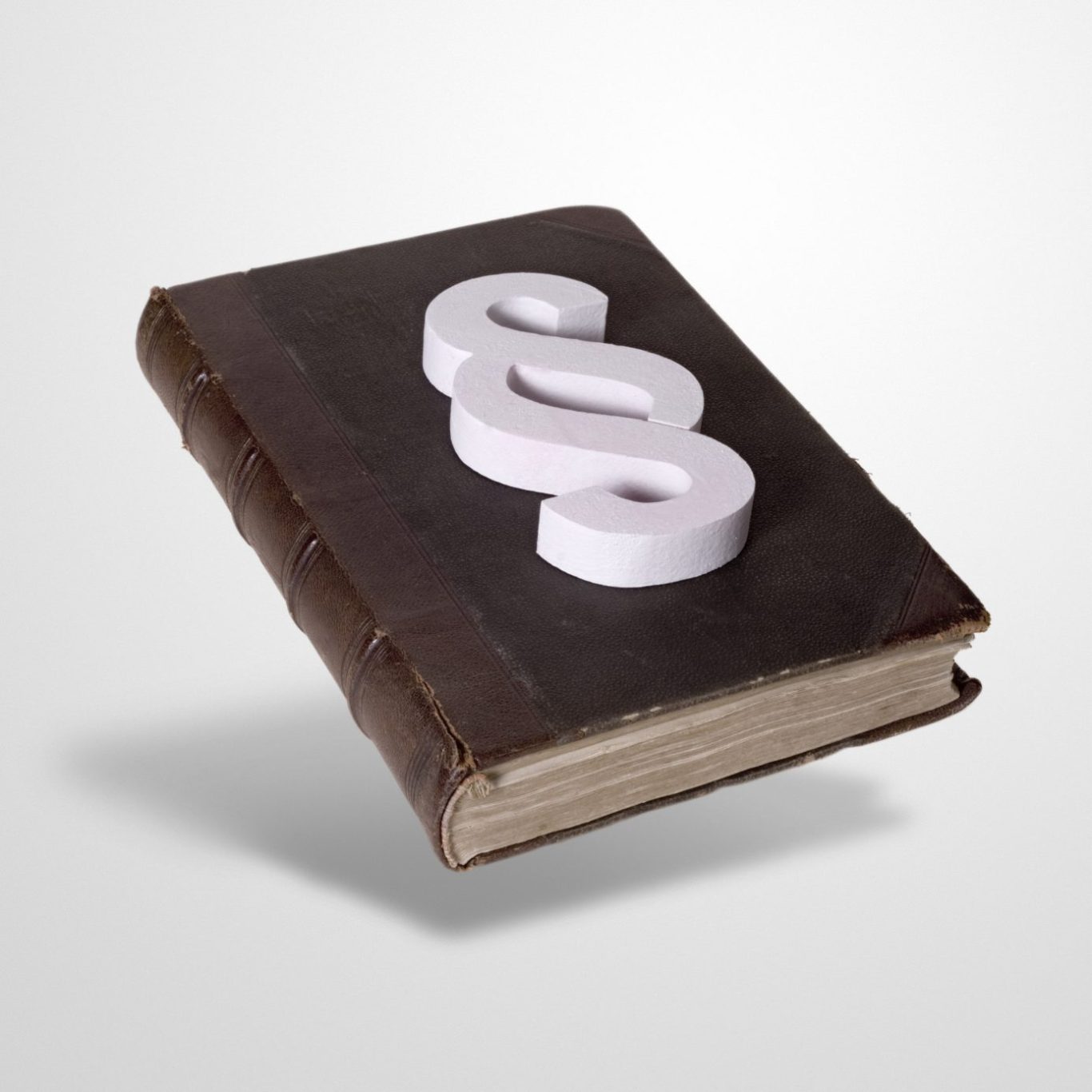
Wo ist das Brandstiftung gesetzlich geregelt?
Strafrechtliche Tatbestände rund um Brandstiftung und Brandstiftungsdelikte
Das Strafgesetzbuch (StGB) enthält spezifische Regelungen zu Brandstiftungsdelikten in den Paragraphen 306 bis 306f StGB.
Brandstiftungsdelikte gehören zu den sogenannten gemeingefährlichen Delikten, welche in den Paragraphen 306 bis 323c StGB aufgeführt sind. All diese Delikte haben gemeinsam, dass sie bei Verwirklichung das Leben, das Eigentum oder die Gesundheit einer unbestimmten Anzahl von Personen gefährden können.
Weil bereits der Grundtatbestand der Brandstiftung gemäß § 306 StGB mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft wird, sind Brandstiftungsdelikte als Verbrechen eingeordnet, was dazu führt dass für eine vorsätzlich begangene Brandstiftung keine Geldstrafe ausgeurteilt werden kann und bereits der Versuch, eine Brandstiftung zu begehen, strafbar ist.
Neben der Brandstiftung gemäß § 306 StGB gibt es im Deliktsfeld der Brandstiftungsdelikte folgende Tatbestände und Qualifikationen:
- Schwere Form der Brandstiftung (§ 306a StGB)
- Besonders schwere Form der Brandstiftung (§ 306b StGB)
- Brandstiftung mit Todesfolge (§ 306c StGB)
- Fahrlässige Brandstiftung (§ 306d StGB)
- Herbeiführen einer Brandgefahr (§ 306f StGB)
Als Besonderheit gibt es nur bei den Brandstiftungsdelikten eine gesonderte Form des straflosen Rücktritts von einer versuchten Brandstiftung, welche gemäß § 303e StGB als Tätige Reue bezeichnet wird. Von dieser Möglichkeit der Strafmilderung oder gar des Absehens von Strafe profitiert derjenige Täter, welcher freiwillig den von ihm verursachten Brand löscht, bevor ein erheblicher Schaden entstanden ist.
Überblick über die wichtigsten Brandstiftungsdelikte
Nachfolgend ein kurzer Überblick über die verschiedenen Delikte aus dem Deliktsfeld der Brandstiftung, einschließlich besonderer Begehungsformen und Qualifikationen.
Brandstiftung
(§ 306 StGB)
Das Grunddelikt der Brandstiftung definiert als Basisdelikt den Schutzbereich der Brandstiftungsdelikte.
Von diesem Verbotstatbestand der Brandstiftung umfasst und damit geschützt sind somit Gebäude oder Hütten, Betriebsstätten oder technische Einrichtungen (Maschinen), Warenlager oder Warenvoräte, Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft-, oder Wasserfahrzeuge, Wälder, Moore oder Heiden, sowie Land-, Ernährungs- oder Forstwirtschaftliche Anlagen und Erzeugnisse.
Die verschiedenen anderen Tatbestände aus dem Deliktsfeld der Brandstiftung beziehen sich auf den Schutzbereich dieses Grundtatbestands.
Mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis hin zu zehn Jahren wird gemäß § 306 StGB bestraft, wer die o.g. Schutzgüter vorsätzlich in Brand setzt oder durch Brandlegung zerstört.
Schwere Form der Brandstiftung
(§ 306a StGB)
§ 306a des Strafgesetzbuches (StGB) beschreibt einen qualifizierten Grundtatbestand im Bereich der Brandstiftungsdelikte als sogenannte schwere Form.
Diese Qualifikation betrifft insbesondere Gebäude, Gebäudeteile und andere Räumlichkeiten welche der Wohnung von Menschen dienen oder andere Räume, in denen sich zeitweise Menschen aufhalten. Ebenfalls umfasst von der schweren Form der Brandstiftung sind Kirchen, Schiffe und Hütten.
Der Strafrahmen beträgt bei der Verwirklichung der Qualifikation ein Jahr bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe.
Ein ganz wesentlicher Aspekt dieses Tatbestands ist, dass es für die Tatbestandsverwirklichung völlig unerheblich ist, ob sich zum Zeitpunkt der Tatausführung tatsächlich Personen in diesen Gebäuden oder Räumlichkeiten befanden, da der Gesetzgeber eine rein abstrakte Gefahrenlage in den Fokus gerückt hat.
In Strafverfahren, die § 306a StGB als schwere Form der Brandstiftung betreffen kann aber die Frage, ob der Täter entlastend argumentieren kann, wenn er sich vor der Tat vergewissert hat, dass sich keine Menschen in den betreffenden Objekten aufhielten im Rahmen der konkreten Strafzumessung von Bedeutung sein.
Besonders schwere Form der Brandstiftung (§ 306b StGB)
Text folgt.
Brandstiftung mit Todesfolge
(§ 306c StGB)
Text folgt.
Fahrlässige Brandstiftung
(§ 306d StGB)
Text folgt.
Herbeiführen einer Brandgefahr
(§ 306f StGB)
Text folgt.
Verfahrensablauf bei Brandstiftungsdelikten
Sofern zu irgendeinem Zeitpunkt die Polizei hinzugezogen wurde, werden Brandstiftungsdelikte aufgrund des bestehenden Legalitätsprinzips grundsätzlich von der Polizei untersucht und ermittelt. Im Regelfall wird die Polizei von der bei Bränden eingesetzten Feuerwehr informiert.
Nachdem die Polizei ihre Ermittlungen des Sachverhalts abgeschlossen (also Beweise gesammelt, Zeugen befragt, Sachverständige mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt und dem Beschuldigten rechtliches Gehör angeboten hat) hat wird der Vorgang an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet, welche sodann über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheidet.
Neben einer grundsätzlich möglichen Einstellung des Strafverfahrens (z.B. gemäß § 170 Abs. 2 StPO mangels hinreichendem Tatverdachts oder der Beauftragung der Polizei mit weitergehenden Nachermittlungen hat die Staatsanwaltschaft nach dem Abschluss der Ermittlungen darüber zu entscheiden, wie mit dem Strafverfahren, welches sich noch im Stadium des Ermittlungsverfahrens befindet weiter zu Verfahren ist. Hier besteht für die Staatsanwaltschaft - mit Ausnahme bei einer vorgeworfenen lediglich fahrlässigen Brandstiftung, bei welcher aufgrund der Einordnung als Vergehen und nicht als Verbrechen auch ein Strafbefehl möglich ist - nur eine Option:
- Anklage gem. § 170 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO)
Bei schwerwiegenderen Straftaten mit einer Straferwartung welche ein Jahr Freiheitsstrafe übersteigt, aber auch bei komplexeren, unklaren oder vom Beschuldigten im Rahmen des Ermittlungsverfahrens bereits bestrittenen Sachverhalten wird die Staatsanwaltschaft bei vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts Anklage vor dem zuständigen Strafgericht erheben.
In diesem Fall übersendet die Staatsanwaltschaft dem Gericht eine Anklageschrift, verbunden mit dem Antrag das Hauptverfahren zu eröffnen.
Dem Angeschuldigten (so ist die Bezeichnung des vormals Beschuldigten in diesem als Zwischenverfahren bezeichneten Verfahrensabschnittes) wird die Anklage vom Gericht - verbunden mit einer Frist zur Abgabe einer Stellungnahme - sodann zugestellt.
Nach Ablauf der Stellungnahmefrist entscheidet das Gericht, ob das Hauptverfahren eröffnet, oder das Verfahren vorläufig eingestellt wird. Im Falle der Eröffnung des Hauptverfahrens wird kurzfristig ein Hauptverhandlungstermin festgelegt und eine entsprechende Terminsladung versendet. In dem Hauptverhandlungstermin wird wird dann in einer mündlichen Gerichtsverhandlung über den Tatvorwurf und die Strafe entschieden.
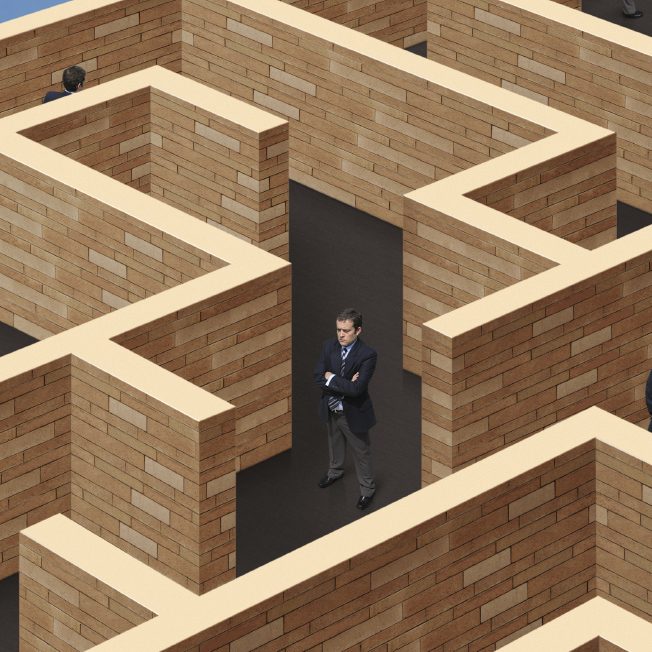
Folgen einer Verurteilung wegen Brandstiftung
Im Bereich des Brandstiftungsdelikte können, wie bei allen anderen Straftaten, unterschiedliche Strafen verhängt werden. Die konkret verhängte Strafe variiert abhängig von Schwere und Art des Verstoßes, sowie den Tat- und Begleitumständen im zu betrachtenden Einzelfall. Maßgeblich ist der gesetzliche Strafrahmen des jeweils verwirklichten Tatbestandes, innerhalb dessen ein Gericht die individuelle Strafe festsetzen muss.
Bis auf die Tatvariante der fahrlässigen Brandstiftung werden alle Brandstiftungsdelikte mit Freiheitsstrafe (Gefängnisstrafe) sanktioniert, welche nur bei einer Höchststrafe von zwei Jahren sowie zusätzlich dem vorliegen weiterer Bedingungen (günstige Sozialprognose) zur Bewährung ausgesetzt werden kann.
Neben der Strafe, bzw. strafrechtlichen Sanktion gibt es insbesondere im Deliktsfeld der Brandstiftung aber noch weitere mögliche Rechtsfolgen und andere Begleiterscheinungen, welche nachstehend genauer beschrieben werden:

Zivilrechtlicher Schadensersatz
Text folgt

Vorstrafe im Führungszeugnis
Text folgt.

Öffentliche Berichterstattung / Presse
Text folgt.
Ihr Experte im Strafrecht - Rechtsanwalt Jascha Briel
Auf Strafrecht und Strafverteidigung spezialisierte Anwaltskanzlei in Hamburg
Im Regelfall (Ausnahme: Fahrlässige Brandstiftung) besteht bei dem Vorwurf der Brandstiftung und Verhandlung vor dem Amtsgericht - Schöffengericht -, Landgericht oder Oberlandesgericht die gesetzliche Verpflichtung sich eines Anwalts als Verteidiger zu bedienen. Dies hat seine Gründe in den gesetzlichen Regeln zur sogenannten notwendigen Verteidigung in § 140 ff. der Strafprozessordnung (StPO). Diese besagen, das bei einer bestimmten Straferwartung ein Pflichtverteidiger im Rahmen einer Pflichtverteidigung zwingend beizuordnen ist. Die Kosten für ihre anwaltliche Vertretung durch einen Pflichtverteidiger werden zunächst von der Staatskasse gezahlt und nur im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung von Ihnen als Teil der Verfahrenskosten zurück verlangt.
Mithin ist die Beauftragung eines im Deliktsfeld der Brandstiftung spezialisierten Strafverteidigers kein Luxus, sondern ein Ihn zustehendes Recht und eine unverzichtbare Notwendigkeit, die Ihren Fall entscheidend beeinflussen kann.
Wenn Sie also von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht aufgefordert werden einen Anwalt als Pflichtverteidiger Ihres Vertrauens zu benennen, zögern Sie nicht sich mit Rechtsanwalt Briel in Verbindung zu setzen und die Übernahme Ihres Mandats im Einzelfall zu besprechen.
Haben Sie wegen eines Ihnen vorgeworfenen Brandstiftung eine Vorladung der Polizei oder bereits eine Anklage erhalten? Zögern Sie nicht, sondern setzen sich zeitnah mit einem erfahrenen Anwalt für Strafrecht in Verbindung! Jeder Moment ohne rechtlichen Beistand könnte z.B. durch das nicht einhalten von wichtigen Fristen Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Verteidigung gefährden.
Rechtsanwalt Jascha Briel nimmt diese Herausforderung in seiner Kanzlei in Hamburg Schnelsen ernst und ist für Sie auch bundesweit tätig. Rechtsanwalt Briel verfügt aufgrund der langjährigen Tätigkeit im Strafrecht über die nötige, umfassende Erfahrung auch bei dem Vorwurf der Brandstiftung um gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Verteidigungsstrategie zu entwickeln.

Rechtsanwalt Jascha Briel
Rechtsanwalt und Strafverteidiger Jascha Briel hat Rechtswissenschaften in Hamburg studiert. Bereits im Studium hat er frühzeitig einen strafrechtlichen Schwerpunkt gewählt und sich seit der Gründung der Kanzlei in Hamburg Schnelsen im Jahr 2016 auf das Rechtsgebiet Strafrecht spezialisiert und in einer Vielzahl von Fällen die Rechte von Mandanten in strafrechtlichen Verfahren vertreten.
Telefon: 040 / 58 91 79 01
E-Mail: kontakt@strafrecht-schnelsen.de
Kanzlei in Hamburg (Schnelsen)
Anschrift:
Glißmannweg 1
22457 Hamburg
Kontakt:
Telefon: 040 / 58 91 79 01
Telefax: 040 / 58 13 17
E-Mail: kontakt@strafrecht-schnelsen.de
Rechtsanwalt Jascha Briel - Individuelle Strafverteidigung nach Maß in Hamburg-Schnelsen
Telefon: 040 / 58 91 79 01 | Adresse: Glißmannweg 1 - 22457 Hamburg (Schnelsen)
©2025 Rechtsanwalt Jascha Briel. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.
